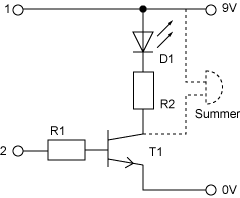|
http://sites.schaltungen.at/elektronik/elko/schaltungen
Wels, am 2016-11-20BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken
*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger
********************************************************I*
~015_b_PrennIng-a_elektronik-elko-schaltungen (xx Seiten)_1a.pdf
EL-KO Schaltungenhttp://www.elektronik-kompendium.de/sites/ http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/index.htm Elektronische Schaltungen und BausätzeSchaltungssammlungen gibt es im Internet wie Sand am Meer.Meist mit unterschiedlicher Qualität und ohne eindeutige Struktur. Deshalb soll das hier keine Kopie oder ein Abklatsch der bekannten Quellen sein, sondern eine Sammlung kleiner sinnvoller Schaltungen, die es auch als Bausatz im ELKO-Shop zu kaufen gibt. Die einzelnen Bausätze sind so dimensioniert, dass möglichst wenig unterschiedliche Bauteile benötigt werden. Außerdem wurde besonderer Wert darauf gelegt sinnvolle Schaltungsteile kombinierbar zu machen, so dass eine Schaltung mehrfach verwendet werden kann. Das spart Bauteile und damit Kosten. Zehn EL-KO Bausätze1. Bauteil-Tester § BC547B LEDrt
5. Taktgenerator § LMC555CN od. TL555CP (NE555 veraltet) BC547B Pot.1M LEDrt
6. Zehn-Kanal Lauflicht § CD4017 10xLED rt 7. Spannungswächter § LM324 LEDrt Pot.10k 8. LED-Blitzer § BC547B npn BC574B pnp LED rt 9. ISDN-Tester § 4x Duo-LED rt/gn 2-pin 0. Pegelwandler mit Transistoren § BC140/16 npn BC557B pnp Wer die oberen Schaltungen nachbauen will, der benötigt generell nur wenige Bauteile. So werden folgenden Bauteile sehr häufig verwendet:
Praktische Schaltungen und Anwendungen
Die folgenden Schaltungen sind größere Artikel, die in Form von Minikursen von Thomas Schaerer zusammengestellt wurden.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm Sie vermitteln neben einem praktischen Teil auch Grundlagen über die Schaltung und die verwendeten Bauelemente.
Zehn EL-KO Bausätze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| R1 | Widerstand | 4,7 kOhm |
| R2 | Widerstand | 470 Ohm |
| T1 | Transistor | BC 547 B |
| D1 | Leuchtdiode | Standard, 5mm, rot |
| 9V-Batterie-Clip |
Schwierigkeitsgrad
Die Schaltung besteht aus insgesamt 4 Bauteilen.Die Schaltung sollte deshalb für Anfänger schnell aufgebaut sein.
Entweder auf einem Steckbrett oder auf eine Lochrasterplatine gelötet.
Weitere verwandte Themen:
2. LED-Lampe
Beschreibung
Dieser Bausatz ersetzt eine kleine Taschenlampe.Zusammen mit einem 1,2V-Akku, der nicht im Lieferumfang des Bausatzes enthalten ist, passen die Bauteile in ein kleines Gehäuse.
Fertig ist die Mini-Lampe mit einer Leuchtdiode (LED).
Das IC in dieser Schaltung ist ein DC-DC-Konverter, der aus einer kleinen Spannung eine große wandeln kann.
Schaltung
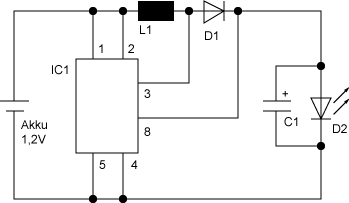
Die Spannung des Akkus beeinflusst die Leuchtstärke der Leuchtdiode D2 nur gering.
Ein Unterschied zwischen 1,2V und 1,5V ist praktisch nicht feststellbar.
Mit dem Kondensator C1 wird die Leuchtdiode heller und führt zum Nachleuchten beim Abschalten der Betriebsspannung.
Wer die Leuchtstärke absenken will, der kann auch diesen Kondensator weglassen.
Die Spule L1 sollte im Optimalfall 82 µH betragen.
Weil dieser Wert schlecht zu bekommen ist, tut es auch 68 µH.
Nur ist dann das Strom-Spannungsverhalten nicht mehr optimal und die Schaltung verbraucht mehr Strom als eigentlich sein müsste.
Mit einem zusätzlichen Schalter oder Taster in Reihe zum Akku, kann die Schaltung (Leuchtdiode) abgeschaltet werden.
Bauteilliste
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| IC1 | DC-DC-Konverter | LT1073-5 |
| L1 | Spule | 82 µH |
| C1 | Kondensator | 220 µF |
| D1 | Diode | 1N5818 |
| D2 | Leuchtdiode | Weiss / Superhell |
Schwierigkeitsgrad
Obwohl dieser Bausatz ein IC enthält, ist diese Schaltung auch für Anfänger geeignet.Diese Schaltung ist schnell aufgebaut und ermöglicht ein schnelles Erfolgserlebnis.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich ein Gehäuse
(z. B. eine Dose oder Schachtel) so anpassen, dass diese Schaltung mit Akku Platz findet.
Weitere verwandte Themen:
3. LED-Lampe ohne IC
Beschreibung
Dieser Bausatz ersetzt eine kleine Taschenlampe.Bereits in einem anderen Bausatz wurde ein DC-DC-Wandler verwendet, der eine Spannung zwischen 1,2 und 1,5 V auf 3,6 bis 4 V wandelt.
Damit ist es möglich eine weiße, sehr helle Leuchtdiode zu betreiben.
Da sich manche Elektroniker nicht an integrierte Schaltkreise (IC) herantrauen und die Schaltung wegen eines ICs teurer und aufwendiger ist, gibt es auch eine Lösung ohne IC.
Also eine Sparlösung, die natürlich auch ihre Nachteile hat.
Diese einfache Schaltung besteht aus zwei Transistoren und zwei Widerständen, die so zusammengeschaltet sind, dass sie als Konstantstromquelle funktionieren.
Nachteilig ist die Betriebsspannung.
Sie beginnt erst bei ca. 4 V und reicht aber bis 16 V.
Diese Schaltung lässt sich also mit einer relativ flexiblen Spannung betreiben.
Funktionsbeschreibung
Der Emitterstrom in T1 steigt soweit an, bis der Spannungsabfall über R2 der Basis-Emitter-Spannung von T2 entspricht.Es fließt ein T2-Basis- und somit ein verstärkter T2-Kollektor- bzw. T2-Emitterstrom.
Der T2-Kollektorstrom entzieht der Basis von T1 gerade soviel Strom, dass die nötige Spannung über R2 konstant bleibt.
Daraus resultiert ein konstanter T1-Kollektorstrom.
Der Widerstand R2 ist so dimensoniert, dass ein Strom von ungefähr 20 mA durch die Schaltung fließt.
Es handelt sich um eine Konstantstromquelle. Ist die Betriebsspannung über 4 V, reicht die Spannung zur Stromregelung und für das Leuchten der Leuchtdiode aus.
Da die Schaltung als LED-Lampe dienen soll, wird eine weiße sehr helle Leuchtdiode verwendet.
Alternativ kann natürlich auch eine andere Leuchtdiode verwendet werden.
Abhängig von der Durchflussspannung dieser Leuchtdiode kann natürlich auch eine kleinere Betriebsspannung ausreichen.
Da die Basis-Emitter-Spannung von T2 als Referenzspannung dient
und dieser Transistor durch den mittelohmigen Widerstand R2 nur wenig belastet wird, ist die gesamte Stromquelle relativ temperaturstabil.
Schaltung
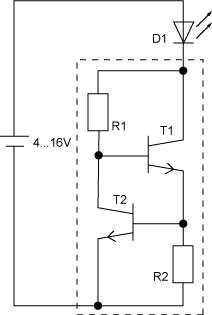
Bauteilliste
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| R1 | Widerstand | 4,7 kOhm |
| R2 | Widerstand | 33 Ohm |
| T1 | Transistor | BC 547 B |
| T2 | Transistor | BC 547 B |
| D1 | Leuchtdiode | Superhell, 9000 mcd, weiss |
Schwierigkeitsgrad
Diese Schaltung hat zwar nur 5 Bauteile.Trotzdem sollte man diese Schaltung nicht unterschätzen.
Durch die komplizierte Verschaltung der Transistoren sind leicht Fehler möglich.
Wer bereits Schaltungen mit Transistoren aufgebaut hat, dürfte keine Schwierigkeiten haben.
Weitere verwandte Themen:
4. LED-Wechselblinker
Beschreibung
Der LED-Wechselblinker ist eine einfache Schaltung mit wenigen Bauteilen, wobei allerdings viel passiert und zum ausprobieren und experimentieren einlädt.Diese Schaltung verdeutlicht das Verhalten von Transistoren und Kondensatoren.
Mit einem Oszilloskop lässt sich sehr leicht feststellen, was in dieser Schaltung passiert.
Funktionsbeschreibung
Diese Schaltung ist ein astabiler Multivibrator, also eine Schaltung deren Zustand sich ständig ändert.Diese Änderung betrifft den Stromfluss und die Spannung, deren Auswirkungen durch die Leuchtdioden sichtbar werden.
Abhängig von der Einstellung des Potentiometers P1 wechseln sich die beiden Leuchtdioden mit blinken ab.
Je nach Einstellung des Potentiometers schneller oder langsamer.
Als Betriebsspannung kommt ein Wert zwischen 3 und 9 V in Frage.
Die Schaltung ist für 9V ausgelegt, funktioniert aber schon mit weniger.
Als Basis werden rote Leuchtdioden verwendet.
Durch die Veränderung der Vorwiderständen R1 und R2 können auch andersfarbige Leuchtdioden verwendet werden.
Die Transistoren müssen nicht zwingend BC 547 B sein, sondern es eignen sich auch BC 238 oder vergleichbare Kleinsignal-Transistoren.
Es empfiehlt sich immer gleichwertige Transistoren zu verwenden.
Sollte einer der Transistoren defekt, falsch oder eine Fehlfunktion haben, so wirkt sich das auf die komplette Funktionalität dieser Schaltung aus.
Ein Leuchtdiode leuchtet dauernd und die andere nur ganz schwach.
Schaltung
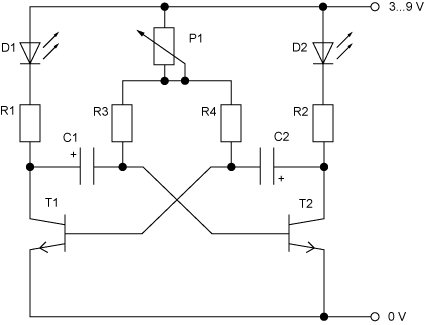
Bauteilliste
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| R1 | Widerstand | 470 Ohm |
| R2 | Widerstand | 470 Ohm |
| R3 | Widerstand | 3,9 kOhm |
| R4 | Widerstand | 3,9 kOhm |
| P1 | Potentiometer | 50 kOhm |
| C1 | Elektrolytkondensator | 47 µF / 16V |
| C2 | Elektrolytkondensator | 47 µF / 16V |
| T1 | Transistor | BC 547 B |
| T2 | Transistor | BC 547 B |
| D1 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D2 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
Dimensionierung
Der hier beschriebene Wechselblinker ist ein simpler astabiler Multivibrator.Das heißt, die Schaltung kennt keinen stabilen Zustand, sondern schwingt ständig zwischen zwei Zuständen hin und her.
Die beiden Transistoren T1 und T2 schalten und sperren sich abwechselnd gegenseitig
Je kleiner der Kondensator bzw. je kleiner der Widerstand, desto schneller verlischt die entsprechende Diode, zugunsten der anderen, die dann sofort aufleuchtet.
- Die Einschaltzeit von T2 beträgt t,ein = 0,7 x R3 x C1, die Ausschaltzeit t,aus = 0,7 x R4 x C2.
- Die Einschaltzeit von T1 beträgt t,ein = 0,7 x R4 x C2, die Ausschaltzeit t,aus = 0,7 x R3 x C1.
Die BE-Sperrschicht von Silizium-Transistoren hat eine maximale Sperrspannung um die 7 Volt.
Darum kann der Betriebsspannungsbereich bis 9 Volt schon außerhalb der zulässigen Grenzwerte der Transistoren sein.
Schwierigkeitsgrad
Die Schaltung lässt sich relativ schnell aufbauen.Sofern kein Verschaltungsfehler gemacht wurde, ist auch ein schneller Erfolg möglich.
Heikel ist in der Regel die Verschaltung des Potentiometers und der Transistoren.
Hinweis für die Simulation
Wenn die Schaltung im Simulator (Multisim, Target, etc.) exakt symmetrisch aufgebaut wird,dann berechnet der Simulator Lade- und Entladezeiten der Kondensatoren genau gleich.
Das bedeutet, die Schaltung funktioniert im Simulator nicht.
Die aufgebaute Schaltung lebt aber davon, dass die Bauteile Toleranzen haben, die die Schaltung geringfügig asymetrisch machen.
Beim Simulieren muss darauf geachtet werden, einen der Kondensatoren einen etwas anderen Wert zu geben.
Simulatoren sind zwar ganz nett, aber ersetzen nicht den Lötkolben!
Weitere verwandte Themen:
- Kippstufen
- Datenblätter für Bausätze
- LED-Lampe
- LED-Lampe ohne IC
- LED-Blitzer
- Taktgenerator mit LMC555CN/TLC555CP
- Blinkschaltungen
5. Taktgenerator mit LMC555CN/TLC555CP
Beschreibung
Der Timer NE555 ist hinreichend bekannt.Jeder der ein einigermaßen steilflankiges Rechtecksignal erzeugen will, kommt um den NE555 nicht herum, wenn die Frequenz nicht oder nur in engen Grenzen von einer Spannung gesteuert werden muss (VCO-Prinzip).
Da dieses Bauteil praktisch veraltet ist, verwenden wir in diesem Bausatz die CMOS-Variante, den LMC555CN.
Selbstverständlich kann auch der TLC555CP verwendet werden.
Beide haben nahezu identische Werte.
Für die Anwendung als Taktgenerator in dieser Schaltung sind die Unterschiede unerheblich.
Einziger nenneswerter Nachteil ist der geringe maximale Ausgangsstrom, den CMOS-Bausteine nun mal haben.
Daher verwenden wir einen Transistor mit Basisvorwiderstand um das Taktsignal zu verstärken und an eine Leuchtdiode zu schalten.
Diese leuchtet dann mit dem Takt auf. Mit einem Potentiometer ist dieser Takt einstellbar.
Er liegt zwischen 1 Hz und 30 Hz.
Diese Schaltung ist als universeller Taktgeber für andere Bausätze dimensioniert.
Die Bauteile D1, T1, R3 und R4 dienen dazu, die Funktion der Schaltung zu überprüfen oder ihr generell einen Sinn zu geben.
Funktionsbeschreibung
Die CMOS-Version des 555-Timer erzeugt unbelastet eine Ausgangsspannung die bis an die positive Betriebsspannung und bis an GND reicht.Dies ermöglicht es, dass mit nur einem Widerstand und einem Kondensator ein exakt zeitsymmetrisches Taktsignal (gleich große Impuls-Pause-Zeit) erzeugt werden kann.
Das Tastverhältnis beträgt exakt 0,5.
Die Taktfrequenz wird vom Kondensator C1, dem Widerstand R1 und Potentiometer P1 bestimmt.
Sie liegt zwischen 1 Hz und 30 Hz. Soll der Taktgeber mit einer höheren Frequenz laufen, dann empfiehlt sich ein kleinerer Widerstand R1 zu nehmen oder einfach komplett darauf zu verzichten.
Letzteres ist nicht unbedingt brauchbar. Befindet sich das Potentiometer P1 im Anschlag, wo sein Widerstand 0 Ohm beträgt, kann der Takt wegen Überlastung der Endstufe aussetzen.
Bei größerer Abweichung von diesem Schaltungsvorschlag empfehle ich die Lektüre des Datenblattes von LMC555CN oder TLC555CP.
Vertauschen sollte man die Pins 1 und 8 vom IC1 nicht.
Beim Einschalten der Betriebsspannung verabschiedet sich dieses Bauteil mit einem lauten Knall, sofern das Netzteil die dazu nötige Leistung liefert.
Aber auch eine (schwache) 9-V-Blockbatterie kann diesem IC an den Kragen gehen.
Diese Schaltung ist für eine Betriebsspannung von 3 bis 12 V ausgelegt.
Ist also auch als Taktgeber für CMOS-Schaltungen geeignet. Es sei allerdings angemerkt, dass bei 3 V die Leuchtdiode nur noch etwa 1,8 mA doch sehr dunkel leuchtet.
Als Abhilfe kann der Widerstand R4 auf einen Wert von 56 Ohm reduziert werden.
Der LED-Strom beträgt dann etwa 18 mA.
Bei Ub = 3V fallen über die Leuchtdiode und über die Kollektor-Emitterspannung des Transistors T1 gut 2 V ab.
Es bleiben für den Widerstand R4 also nur noch 1 V übrig.
Daher der niedrigen Widerstandswert bei 3 V. Bei Ub = 12 V fallen über den Widerstand R4 10 V ab.
Dort sind dann die 560 Ohm genau richtig um die Leuchtdiode mit 18 mA zu betreiben.
Wenn die Schaltung nur mit 3 V betrieben wird und man setzt für ausreichenden LED-Strom R4 auf 56 Ohm, ist der Basiswiderstand R3 zu hochohmig.
Mit 22 k-Ohm fliesst gerade noch ein Strom von etwa 0,1 mA.
Dies fordert vom Transistor T1 eine Stromverstärkung von 180 und das ist zuviel wenn T1 durchgeschaltet sein soll.
Daher muss man den Widerstand R4 soweit reduzieren, dass die Stromverstärkung etwa 30 bis 40 beträgt.
Schaltung
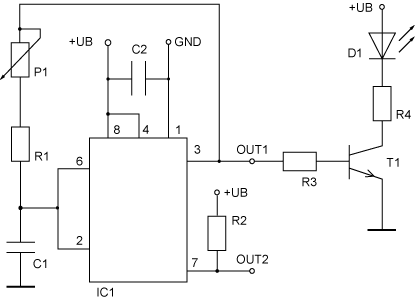
Bauteilliste
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| P1 | Potentiometer | 1 MOhm |
| R1 | Widerstand | 47 kOhm |
| R2 | Widerstand | 1 kOhm |
| R3 | Widerstand | 22 kOhm |
| R4 | Widerstand | 560 Ohm |
| D1 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| T1 | Transistor | BC 547 B |
| IC1 | Timer 555 (CMOS) | LMC555CN/TLC555CP |
| C1 | Kondensator | 1 µF (Tantal) |
| C2 | Kondensator | 100 nF (z. B. MKS) |
Schwierigkeitsgrad
Der Timer 555 wird immer wieder gerne von Anfängern verwendet.Dieser integrierte Schaltkreis ermöglicht unglaublich viele Anwendungen.
Diese Schaltung ist die einfachste Art den Timer 555 zu verwenden.
Die Transistorstufe lässt sich natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen.
Zum Beispiel um ein Relais zu schalten.
Es gibt im ELKO einige weitere Anwendungen.
- Schmitt-Trigger mit CMOS-555-Timer und praktische Anwendung von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator von Thomas Schaerer
- 555-CMOS: Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt-Funktion von Thomas Schaerer
- 555-CMOS-Timer von Thomas Schaerer
- Das MonoFlipflop und eine praktische Anwendung von Thomas Schaerer
- Positive Zusatzspannung mit dem LMC555 von Thomas Schaerer
Weitere verwandte Themen:
6. Zehn-Kanal Lauflicht
Beschreibung
Dieses Lauflicht hat 10 Kanäle oder zum besseren Verständnis 10 Ausgänge für Leuchtdioden.Es ist eine klassische Lauflichtschaltung. Das IC ist ein BCD-Zähler (CMOS) mit bereits auskodierten Ausgängen.
Das bedeutet, dass nicht einfach nur der Takt hochgezählt wird, sondern gleichzeitig auch pro Takt ein anderer Ausgang beschaltet wird.
Insgesamt hat der Zähler 10 Ausgänge, an denen jeweils eine Leuchtdiode angeschlossen ist.
Abhängig vom Takt leuchten die Leuchtdioden nacheinander auf.
Für den Takteingang (CLK) ist nicht zwingend ein Taktgeber notwendig.
Mit einem Trick kann kann dieser Takteingang angeregt werden.
Schließt man dort einen Draht an und kommt in die Nähe dieses Drahtes, so beginnt das Lauflicht zu laufen.
Allerdings lässt sich das nicht regeln und funktioniert nur aufgrund eines physikalischen Effektes und das nicht besonders zuverlässig.
Zum Bausatz empfiehlt sich ein Taktgenerator.
z.B. Mit LMC555CN oder TLC555CP, den es auch als Bausatz gibt.
Selbstverständlich kann jede andere Art von Taktgeber verwendet werden.
Am Takteingang des BCD-Zählers liegt ein Schmitt-Trigger, der auch noch aus einer Sinusschwingung für den internen Zähler ein brauchbares Rechtecksignal macht.
Funktionsbeschreibung
Die Betriebsspannung dieses Bausatzes ist für 3 bis 12 V ausgelegt.Der Vorwiderstand R1 für die Leuchtdioden ist für rote Standard-Leuchtdioden ausgelegt.
Mit anderen Widerstand-Leuchtdioden-Kombinationen sind auch andere Farben möglich.
Unter Umständen muss dann jede Leuchtdiode einen eigenen Vorwiderstand bekommen.
Da immer nur eine Leuchtdiode leuchtet wird nur ein einziger Vorwiderstand benötigt, über den alle Dioden an Masse liegen.
Als Takt eignen sich Frequenzen im Hz-Bereich. Bei einer zu schnellen Taktfrequenz sieht man das Licht nicht mehr laufen.
Stattdessen flackern die Leuchtdioden oder die Laufgeschwindigkeit ist so hoch, dass das menschliche Auge sie nicht mehr wahrnehmen kann.
Ist die Frequenz zu gering, ist es ein sehr langsames Lauflicht.
Damit das Licht auch wirklich läuft und nicht einfach nur hin und her springt, ist auf die exakte Reihenfolge der Beschaltung der Ausgänge des 4017er zu achten.
Schaltung
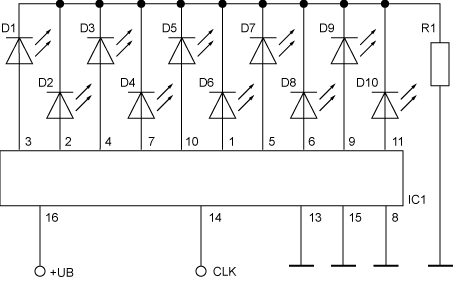
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| IC1 | BCD-Zähler | CD4017 |
| R1 | Widerstand | 560 Ohm |
| D1 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D2 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D3 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D4 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D5 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D6 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D7 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D8 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D9 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| D10 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
Schwierigkeitsgrad
Der integrierte Schaltkreis (IC) ist ein CMOS-Baustein.Diese Logik muss etwas vorsichtiger behandelt werden als
z.B. TTL. Daher empfiehlt sich allgemeine Hinweise zu CMOS zu beachten.
Ansonsten ist diese Schaltung relativ einfach.
Weitere verwandte Themen:
7. Spannungswächter mit LM324
Beschreibung
Schaltungen, die über eine Batterie oder einem Akku mit Strom versorgt werden, haben immer den Nachteil, dass sobald die Spannungsversorgung nachlässt, die Schaltung ausfällt.Da wäre es gut, wenn der vorzeitige Ausfall angezeigt wird.
Dieser Bausatz ist ein sehr simpler Spannungswächter für den Spannungsbereich 3 bis 12 V.
Mit einem Potentiometer wird der Schwellwert eingestellt, bei dem die Leuchtdiode leuchtet bzw. nicht leuchtet.
Bei einer zu niedrigen Spannung leuchtet sie.
Liegt die Spannung über dem Schwellwert leuchtet sie nicht.
Wird der Vorwiderstand der Leuchtdiode vergrößert, sind auch Gleichspannungen bis 30V überwachbar.
Dafür ist der Operationsverstärker LM324 ausgelegt.
Der LM324 ist ein vierfach Operationsverstärker.
Gebraucht wird aber nur einer davon.
Funktionsbeschreibung
- Stellen Sie die Betriebsspannung so ein, wie sie mindestens betragen muss.
- Drehen Sie am Potentiometer P1 so lange, bis die LED von leuchtend auf nicht leuchtend umspringt (grobe Einstellung).
- Bringen Sie das Potentiometer P1 so in Position, dass die Leuchtdiode gerade aus geht (feine Einstellung).
- Regeln Sie die Betriebsspannung herunter. Im Optimalfall leuchtet die Leuchtdiode beim Unterschreiten ihrer gewünschten Spannung.
- Wenn nicht, stellen Sie die Spannung etwas höher ein und gehen zu Punkt 2 zurück.
Für das Potentiometer P1 empfiehlt sich ein feines präzises Potentiometer,
da der Punkt, wo die Spannung am Ausgang umspringt sehr genau eingestellt werden muss.
Einfache Potentiometer können aber auch verwendet werden.
Die Einstellung muss dann aber mehrmals nachgeregelt werden, bis die Schaltung wie gewünscht funktioniert.
Zur Erzeugung der Referenzspannung kommt eine Siliziumdiode zum Einsatz.
Diese hat eine einigermassen stabile Spannung von etwa 0,6V.
Eingermaßen deshalb, weil der Strom durch sie stark von der Betriebsspannung abhängt, die zwischen 3 V und 30 V betragen darf.
Das spielt bei dieser Anwendung jedoch keine große Rolle, weil mit P1 die Spannung eingestellt wird,
bei der der Komparator kippt und da gilt dann einfach die Spannung über D1, welche dann vorhanden ist.
Diese einfache Referenzschaltung eignet sich vielleicht nicht, wenn die Schaltung hohen Temperaturen ausgesetzt ist, weil man bedenken muss, dass die Si-Diode einen Temperatur-koeffizienten von etwa -2 mV pro Grad Celsius hat.
Bei einem Temperaturunterschied von 20 Grad Celsius sind dies dann 40 mV und das ist doch eine Abweichung der eingestellten Kippspannung von etwa 6,6 Prozent.
Ob dies tolerabel ist, kommt ganz auf die Anwendung an.
Schaltung

| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| IC1 | Operationsverstärker | LM324 |
| P1 | Potentiometer | 10 kOhm |
| R1 | Widerstand | 10 kOhm |
| R2 | Widerstand | 560 Ohm |
| D1 | Diode | 1N4148 |
| D2 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| IC-Fassung | DIP14 |
Schwierigkeitsgrad
Einfache, kleine und praktische Anwendung eines Operationsverstärkers.Es empfiehlt sich einen Blick ins Datenblatt des LM324 zu werfen, um die Pinbelegung eines der insgesamt 4 Operationsverstärker zu erfahren.
Weitere verwandte Themen:
- Datenblätter für Bausätze
- Spannungskontrolle
- Bauteil-Tester
- 555-CMOS: Sparsame Batteriebetriebsanzeige mit Lowbatt-Funktion von Thomas Schaerer
- R A I N B O W , die Batterieladezustandsanzeige von Thomas Schaerer
8. LED-Blitzer / LED-Blinker
Beschreibung
Der LED-Blitzer oder auch LED-Blinker ist eine Schaltung mit zwei Transistoren, einer Leuchtdiode und ein kleinwenig Beschaltung drumherum.Ziel dieser Schaltung ist es mit möglichst wenig Strom und Spannung eine Leuchtdiode kurz zum Aufblitzen zu bringen.
Wird die Schaltung mit einer Batterie oder einem Akku betrieben funktioniert sie sehr lange.
Daher wird diese Schaltung auch Lebenslicht genannt, weil sein ein Leben lang brennt.
Bei einer Spannung zwischen 3 und 12 V kann auch eine leere Batterie noch genug Strom liefern um die Leuchtdiode dauerhaft zum Blitzen zu bringen.
Optimal funktioniert die Schaltung zwischen 3 und 5 V.
Hier sind die Blinkfrequenz und die Blinkintensität am Besten eingestellt (subjektives Empfinden).
Funktionsbeschreibung
Eine vergleichbare Schaltung wäre sicherlich auch mit einem NE555/LMC555/TLC555 möglich gewesen.Die Besonderheit dieser diskret aufgebauten Schaltung ist die Zusammenschaltung von Transistor T1 und T2. T1 ist ein NPN-Transistor.
T2 ist ein PNP-Transistor. Beide sind so angeordnet, dass ein Thyristor entsteht.
Für das Blitzen der Leuchtdiode macht man sich den Thyristor-Effekt zu nutze.
Ü ber den Widerstand R2 wird der Kondensator C1 aufgeladen.
Anfänglich ist der Spannungsabfall über Widerstand R2 sehr groß.
Die Diode D1 und der Widerstand R1 bilden den Basisspannungsteiler für den Transistor T2,
wobei D1 als niederohmige Referenzspannungsquelle mit der typischen Durchflussspannung von etwa 0,7 V dient.
Wenn der Spannungsabfall am Widerstand R2 geringer ist als die Differenz aus Basis-Emitter-Spannung von T2
und der Flussspannung von Diode D1, also der Kondensator C1 fast aufgeladen ist, dann steuert der Widerstand R1 den Transistor T2 durch.
Der Kollektorstrom steuert wiederum den Transistor T1 durch.
Es entsteht ein gegenseitiges aufschaukeln beider Transistoren.
Man nennt das den Lawinen-Effekt oder in diesem Fall den Thyristor-Effekt.
An einem bestimmten Punkt wird der Kondensator C1 über die Leuchtdiode entladen.
Ein kurzer Stromfluss führt zum Lichtblitz. Ist die Ladung des Kondensators zusammengebrochen sperren die Transistoren wieder
und der beschriebene Ablauf beginnt von neuem.
Wird der Akku oder die Batterie älter verringert sich die Spannung und der Innenwiderstand der Stromquelle wird größer.
Dieser Innenwiderstand addiert sich zum Widerstand R2.
Die Blinkfrequenz zieht sich dadurch auseinander.
Die geringere Spannung verkürzt wiederum die Blinkfrequenz.
Die Folge ist, dass auch alte Flach- und Blockbatterien und Akkus aufgebraucht werden können, bis sie vollständig platt sind.
Die Intensität des Lichtblitzes wird von der Betriebsspannung und dem Kondensator C1 beeinflusst.
Die Blinkfrequenz wird durch den Widerstand R2 und dem Kondensator C1 bestimmt.
Bei einer höheren Kapazität des Kondensator wird die Blitzfrequenz langsamer aber intensiver.
Bei einer niedrigeren Kapazität schneller und weniger intensiv.
Wichtig:
Hat der der Kondensator eine hohe Kapazität und die Schaltung wird unter Spannung gesetzt, dann dauert es einige Augenblicke,
bis die Leuchtdiode blitzt, denn der Kondensator muss erst aufgeladen werden.
Schaltung
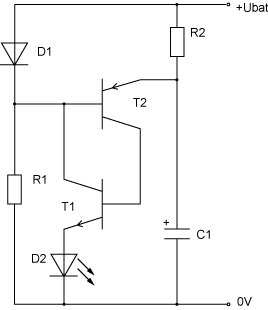
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| R1 | Widerstand | 330 kOhm |
| R2 | Widerstand | 6,8 kOhm |
| T1 | Transistor | BC 547 B |
| T2 | Transistor | BC 557 B |
| D1 | Diode | 1N4148 |
| D2 | Leuchtdiode | Standard, 5 mm, rot |
| C1 | Elektrolytkondensator | 47 µF oder 100 µF / 16V |
Schwierigkeitsgrad
Der Sinn hinter dieser Schaltung ist nicht besonders groß.Allerdings lässt sich damit gut experimentieren. So sind
z.B. Der Widerstand R2 und der Kondensator C1 austauschbar.
In Zusammenhang mit der Betriebsspannung lassen sich unterschiedliche Blinkfrequenzen und Blinkintensitäten erreichen.
Wenn es nach dem Aufbau einfach nicht Blitzen sollte, dann einfach mal überprüfen, ob Kollektor und Emitter der Transistoren vertauscht sind.
Weitere verwandte Themen:
9. ISDN-Tester
Beschreibung
Mit diesem ISDN-Tester kann ein ISDN-Anschluss darauf geprüft werden, ob er richtig angeschlossen ist.Über die Leuchtdioden wird angezeigt, ob die Adern richtig angeschlossen sind, Vertauschungen bestehen oder ein Kabelbruch vorliegt.
Damit die Schaltung richtig funktioniert müssen alle Abschlusswiderstände (2 x 100 Ohm) aus dem S0-Bus ausgebaut werden.
Funktionsbeschreibung
Eine grün leuchtende Leuchtdiode zeigt, dass die Ader richtig angeschlossen ist.Eine rot leuchtende Leuchtdiode zeigt, dass die Ader an der falschen Klemme angeschlossen ist.
Meist leuchtet dann noch eine andere Leuchtdiode rot.
Es reicht dann, wenn man diese beiden Adern miteinander tauscht.
Leuchtet eine Leuchtdiode gar nicht, dann besteht keine Verbindung zwischen TK-Anlage/NTBA und UAE-Dose (RJ-45).
Eventuell ist sogar die Dose defekt.
Schaltung
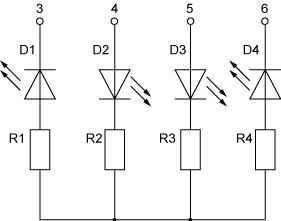
| Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
|---|---|---|
| R1 | Widerstand | 3,3 kOhm |
| R2 | Widerstand | 3,3 kOhm |
| R3 | Widerstand | 3,3 kOhm |
| R4 | Widerstand | 3,3 kOhm |
| D1 | Leuchtdiode | Duo-LED, rot/grün, 2 Pin, 3mm |
| D2 | Leuchtdiode | Duo-LED, rot/grün, 2 Pin, 3mm |
| D3 | Leuchtdiode | Duo-LED, rot/grün, 2 Pin, 3mm |
| D4 | Leuchtdiode | Duo-LED, rot/grün, 2 Pin, 3mm |
| RJ-45-Stecker mit Kabel | Belegung 3-4-5-6 |
Schwierigkeitsgrad
Dieser Bausatz ist einfach aufzubauen.Einziger Knackpunkt ist die richtige Polung der Leuchtdioden.
Wird hier ein Fehler gemacht, dann ist die ganze Schaltung Murks.
Weitere verwandte Themen:
- Datenblätter für Bausätze
- ISDN - Integrated Services Digital Network
- S0-Bus
- UAE - Universal-Anschluss-Einheit
- RJ45-Stecker für Ethernet
- Installationskabel auszählen
10. Pegelwandler mit Transistoren
Pegelwandler von TTL-Spannung nach +12 V
Die Schaltung besteht aus 2 Emitterstufen, wobei der Kollektorwiderstand des Transistors V1 gleichzeitig der Basis-Vorwiderstand des Transistors V2 ist.Die erste Emitterstufe inveriert das Signal, die zweite Emitterstufe invertiert das Signal ebenfalls und setzt die Ausgangsspannung auf 12 V herauf.
Schaltung
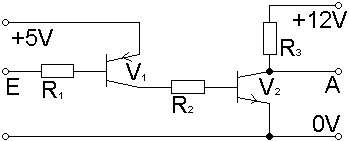
Dimensionierung
| Stromverstärkung B | 80 | 50 |
|---|---|---|
| Widerstand R1 | 270 kΩ | 270 kΩ |
| Widerstand R2 | 4,7 kΩ | 5,6 kΩ |
| Widerstand R3 | 330 Ω | 330 Ω |
| Transistor V1 | PNP | |
| Transistor V2 | BC 140/16 (NPN) | |
Pegelwandler von TTL-Spannung nach V.24
Wenn der Eingang auf 0 V liegt leiten alle Transistoren, und die Ströme I1 - I4 fließen.Am Ausgang liegt dann +12 V an.
Wenn der Eingang auf 5 V liegt sperren alle Transistoren, und am Ausgang liegt -12 V an.
Die Schaltung erkennt nur die Zustände total leitend oder total sperrend.
Schaltung
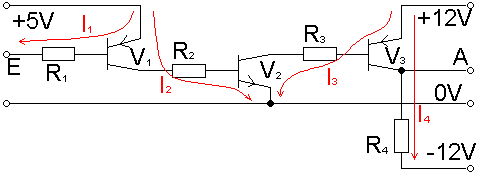
Dimensionierung
| Widerstand R1 | 100 kΩ (0,05 mA) |
|---|---|
| Widerstand R2 | 22 kΩ (0,25 mA) |
| Widerstand R3 | 3,3 kΩ (4 mA) |
| Widerstand R4 | 1 kΩ (24 mA) |
| Transistor V1 | PNP |
| Transistor V2 | BC 140/16 |
| Transistor V3 | PNP |
Pegelwandler von TTL nach +24V
Eingangsstrom kleiner 1 mA.
Schaltung
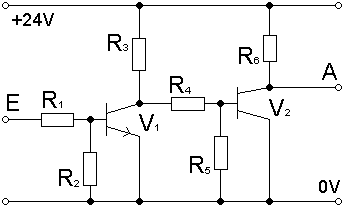
Dimensionierung
| Transistor V1 | BC 107 |
|---|---|
| Transistor V2 | BC 107 |
| Widerstand R1 | 4k7 |
| Widerstand R2 | 1k5 |
| Widerstand R3 | 10k |
| Widerstand R4 | 8,2k |
| Widerstand R5 | 1k5 |
| Widerstand R6 | 2k2 |
Schwierigkeitsgrad
Diese Pegelwandler sind teilweise recht einfache Transistor-Schaltungen mit denen sich hervorragend experimentieren lassen.Die Bauteilwerte sind mit Sicherheit nicht perfekt berechnet oder gewählt.
Es gibt mit bestimmt noch einiges zu optimieren.
Doch Vorsicht. Die Transistoren sind als Schalter dimensioniert.
Die Verlustleistung der Transistoren muss beachtet werden.
Weitere verwandte Themen:
- Datenblätter für Bausätze
- Transistor als Schalter
- Schalten und Steuern mit Transistoren I von Thomas Schaerer
- Der analoge Schalter I (der JFET) von Thomas Schaerer
Quelle:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/index.htm
DIN A4 ausdrucken
********************************************************I*
Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE