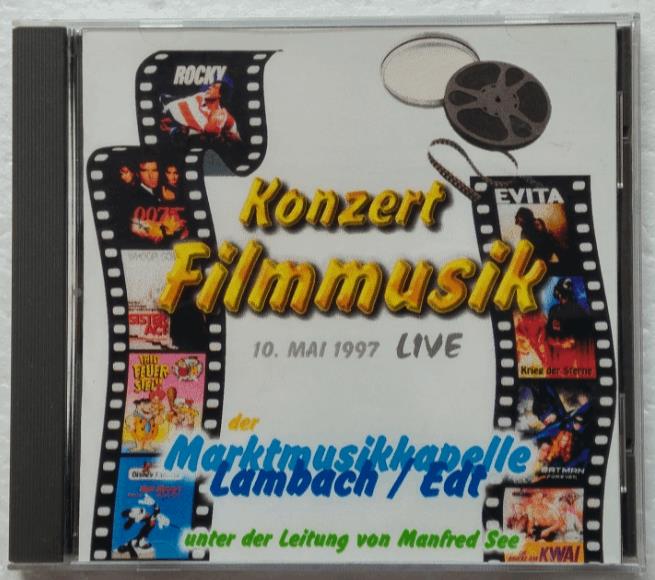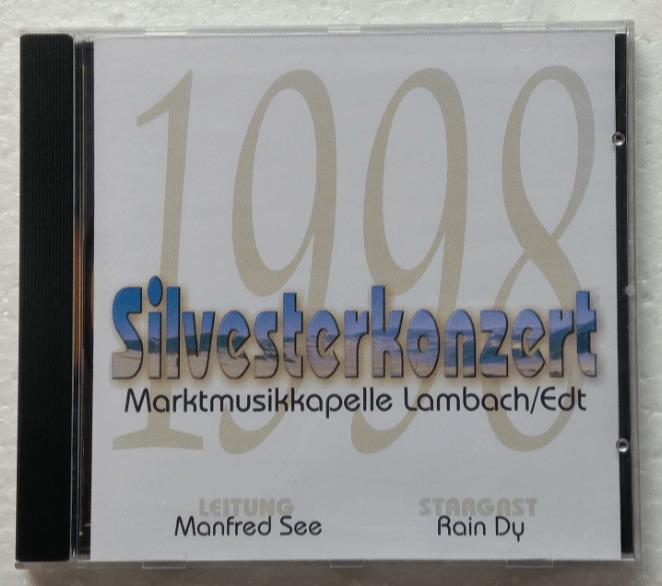|
http://sites.schaltungen.at/elektroni/tonstudiotechnik
Wels, am 2016-07-02BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld [ ] [ Diese Site durchsuchen]DIN A3 oder DIN A4 quer ausdrucken
*******************************************************************************I** DIN A4 ausdrucken (Heftrand 15mm / 5mm) siehe http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger
********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_elektronik-tonstudiotechnik (xx Seiten)_1a.pdf
Mikrofone
Mittelohmige Mikrofon Ausgangsimpedanz 600 .. 2.000 Ohm Niederohmige Mikrofon Impedanz 200 Ohm (100 Ohm) - Dynamische Mikrofone 300_b_Sengpielaudio-x_Größe der Impedanzen in der Tontechnik - Analog (Mikrofonimpedanz)_1a.pdf Das Kohlemikrofon entstammt hauptsächlich der Telefonie und da war ein nicht linearer Frequenzgang von 300Hz bis 3kHz angesagt
ECM Elektret Kondensator Mikrofon / Elektret-Kondensatormikrofon-Kapsel
Man unterscheidet zwischen zweipoligen und dreipoligen Kapseln. Dreipolige Kapseln werden vorzugsweise in Drainschaltung betrieben, während zweipolige Kapseln in Sourceschaltung, siehe Bild, betrieben werden. Damit entfällt bei zweipoligen Kapseln die Zuführung der Betriebsspannung über eine eigene Leitung bzw. Steckerkontakt. Während die dreipolige Variante geringen Klirrfaktor sichert, gibt die zweipolige Variante die Möglichkeit, über einen ebenfalls zweipoligen 3,5 mm-Klinkenstecker an die Soundkarte eines PCs angeschlossen zu werden. Deshalb findet man diese Variante als Standard bei Soundkarten. Elektretmikrofon mit integriertem FET, Frequenzbereich 20Hz bis 16kHz, Empfindlichkeit 7,9mV/Pa/1kHz, Ausgangsimpedanz 1..2 kOhm, Signal/Rauschabstand >58 dB, Koppelkondensator 0,1..4,7uF, Stromversorgung 1,5..10 V /0,5 mA https://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon Gute Mikrofone haben Ausgänge von 30-60 Ohm, wenn man die einschlägigen Seiten von Neumann, Gefell, Sennheiser und AKG durchsucht. Für optimale Resultate sollte die Lastimpedanz mindestens das 3 bis 5-fache der Ausgangsimpedanz betragen. Hat also das Mikrofon eine Ausgangsimpedanz von 200 Ohm, dann sollte die Eingangsimpedanz des Vorverstärkers 600 bis 1.000 Ohm betragen. Und genau diesen Wert findet man in den meisten Mikrofondatenblättern als „Nennlastimpedanz“ oder „Abschlussimpedanz“. Dabei handelt es sich um die minimale Impedanz, für die der Hersteller alle übrigen Spezifikationen im Datenblatt garantiert. Der Eingangswiderstand sollte immer so hochohmig wie nötig Mikrofon Eingangsimpedanz ist heute meist 22k oder 47k Mischpult Eingänge
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofonsignal http://www.sengpielaudio.com/Rechner-EingangsAusgangsWiderstand.htm http://www.sengpielaudio.com/GroesseDerImpedanzen.pdf http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm In Deutschland ist bei professionellen Studios immer noch +6dBu (ARD Studiopegel) Standard. Das entspricht 1.55V(eff. Das u heißt hier "unloaded" also das die Senke unspezifiziert und hochohmig ist) 0dBu = 0,775VDer Homerecording Pegel liegt bei -10dBV (0,3162 Volt) das entspricht -7,78dBuDas V im Index bedeutet dabei bezogen auf 1V also 0dBV = 1V *******************************************************I* Anschluss einer Elektret Mikrofon Kapsel  Der Testkandidat, eine gewöhnliche Elektret Kapsel Üblicherweise besitzen diese Mikrofonkapseln einen eingebauten Feldeffekt Transistor, der als Vorverstärker sowie als Impedanzwandler dient, da das eigentliche Elektret Mikrofon sehr hochohmig ist. Doch wie schliesst man diese Mikrofone an und welche Spannungswerte und Signalpegel sind dabei in der Praxis zu erwarten ? Und wieviel Strom braucht so eine Kapsel ? In diesem Artikel soll eine handelsübliche Mikrofonkapsel näher untersucht werden. Es handelt sich um das Modell MCE100 von Reichelt, technische Daten siehe hier.  Hier der Schaltplan, welcher für die Messungen verwendet wurde. Das Datenblatt nennt einen Betriebsstrom von 0.5 mA sowie einen Lastwiderstand von 2.2 kOhm. Gemessen habe ich unter Realbedingungen einen Strom vom 0.20 bis 0.23mA, im beobachteten Betriebsspannungsbereich von 3 bis 10 Volt. Die Elektret Mikrofonkapsel verhält sich also in etwa wie eine Konstantstromquelle. Somit gestaltet sich der Anschluss in einem weiten Betriebsspannungsbereich recht einfach. Lediglich den Lastwiderstand anschliessen, welcher im etwas spärlichen Datenblatt mit 2.2 k beschrieben wird, und das Signal mit einem Kondensator auskoppeln.
Als Koppelkondensator habe ich einen 1uF Folienkondensator verwendet. Dieser Koppelkondensator bestimmt die untere Grenzfrequenz, je grösser dieser ist, desto tiefere Frequenzen können übertragen werden. Für die nachfolgenden Messungen habe ich also eine Betriebsspannung von 5 Volt angelegt, was einen Arbeitspunkt mit 0.21mA Ruhestrom ergab. Um beurteilen zu können, welche Ausgangsspannungen nun so eine Kapsel erzeugt, habe ich drei verschiedene Schallereignisse aufgezeichnet, natürlich sind diese Messungen nur als grober Anahltspunkt zu verstehen, aber zumindest kann man damit erste Abschätzungen für die Praxis ableiten. Fazit:
Für einen weiten Betriebsspannungsbereich genügt ein Vorwiderstand von typischerweise 2.2k Ohm, die Kapsel stellt sich dabei selbsttätig auf einen konstanten Strom von einigen 100 Mikroampere ein.
http://www.loetstelle.net/praxis/elektretmikrofon/elektretmikrofon.php
********************************************************I*
Von www.schaltungen.at downloadbar
x501_b_FRANZIS-s_5429-8 Handbuch der Tonstudiotechnik (769 Seiten)_1a.pdf Handbuch der Tonstudiotechnik € 39,95
für Film, Funk und Fernsehen
von Johannes Webers E-Book
Seiten: 769
Gebundene Ausgabe: 768 Seiten Verlag: Franzis Auflage: 9., Aufl. (5. November 2007) Sprache: Deutsch ISBN-10: 3-772-35429-7 ISBN-13: 978-3-7723-5429-8 Buch
Größe: 17,5x5,2x23,7cm
Webers' Handbuch der Tonstudiotechnik für Schallaufnahme und -wiedergabe ist das Nachschlagewerk für alle, die sich mit Elektroakustik auf Studioniveau beschäftigen.
Neu in dieser Auflage Die vorliegende 9. Auflage enthält wichtige, zeitgemäße Anpassungen und Erweiterungen: Dies betrifft Themen, die bei Tonaufnahmen für Fernsehen und Film von Bedeutung sind, wie die Probleme der Lichtgestaltung bei Tonaufnahmen mit Bild und die Beschallung von Auditorien bei Veranstaltungen mit Publikum. Im Bereich der vielkanaligen stereofonischen Bearbeitung und Übertragung sind dies die verschiedenen Dolby-Surround-Systeme in Verbindung mit dem 3/2-Stereo-Standard bis hin zur Wellenfeldsynthese. Dazu gehört auch die Signalverteilung auf bis zu sieben Stereokanäle bei der Audiomischung internationaler Spielfilme.
Welches Speichermedium ist geeignet
Lichttonverfahren Darüber hinaus findet der Leser die magneto-optischen Aufzeichnungssysteme MOD und MiniDisc. Die digitalen Lichttonverfahren DOLBY SR*D, SONYSDDS und DTS behandelt ein eigenes Kapitel.
Neueste Studiotechnik Hard-Disk-Systeme und das „bandlose Studio" in Verbindung mit nicht linearen Editing-Systemen (NES), wie AVID, FAIRLIGHT, LIGHTWORKS, MONTAGE und PROTOOLS, werden mit Erfahrungen aus der Praxis angereichert und ausführlich behandelt.
Aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis Einleitung.............................................................................................................. 21 A. Physikalische Grundbegriffe............................................................. 23 I. Schwingungen ................................................................................................ 23 1 Einfache Schwingungen ............................................................................ 24 2 Überlagerung von Schwingungen.............................................................. 25 2.1 Überlagerung von Schwingungen gleicher Frequenz ......................... 25 2.2 Überlagerung von Schwingungen ungleicher Frequenz ..................... 27 3 Modulation von Schwingungen................................................................. 31 3.1 Amplitudenmodulation........................................................................ 31 3.2 Frequenzmodulation............................................................................ 33 3.3 Phasenmodulation ............................................................................... 37 4 Analyse von Schwingungen ...................................................................... 37 4.1 Analyse periodischer Schwingungen .................................................. 37 4.2 Analyse nichtperiodischer Schwingungen .......................................... 41 II. Entstehung von Verzerrungen und Verzerrungsmaße ................................... 42 1 Lineare Verzerrungen ................................................................................ 42 1.1 Dämpfungsverzerrungen ..................................................................... 42 1.2 Phasenverzerrungen ............................................................................ 44 2 Nichtlineare Verzerrungen......................................................................... 44 2.1 Entstehung nichtlinearer Verzerrungen............................................... 44 2.2 Maße nichtlinearer Verzerrungen........................................................ 49 2.2.1 Klirrkoeffizienten und Klirrfaktor .............................................. 49 2.2.2 Differenztonfaktoren .................................................................. 49 2.2.3 Modulationsfaktoren................................................................... 50 2.2.4 Identität der verschiedenen Verzerrungsmaße............................ 50 2.2.5 Gründe für die Vielzahl der Verzerrungsmaße........................... 52 3 Modulationsverzerrungen .......................................................................... 54 3.1 Amplitudenmodulationsverzerrungen ................................................. 54 3.2 Frequenzmodulationsverzerrungen ..................................................... 54 III. Akustische Grundbegriffe .............................................................................. 55 1 Das Schallfeld............................................................................................ 55 1.1 Kenngrößen einer fortschreitenden ebenen Schallwelle...................... 56 1.2 Kugelwelle .......................................................................................... 59 1.3 Schallenergie ....................................................................................... 61 1.4 Gestörte Schallausbreitung ................................................................. 63 1.4.1 Reflexion .................................................................................... 63 1.4.2 Stehende Wellen ......................................................................... 66 1.4.3 Brechung..................................................................................... 69 1.4.4 Schalldämpfung und Schalldämmung ........................................ 71 Schalldämpfung .......................................................................... 72 Schalldämmung .......................................................................... 73 1.4.5 Beugung...................................................................................... 76 2 Raumakustik .............................................................................................. 78 2.1 Geometrische Raumakustik................................................................. 78 2.1.1 Diffusität in Räumen mit ebenen Begrenzungsflächen .............. 79 2.1.2 Räume mit gekrümmten Begrenzungsflächen............................ 81 2.1.3 Räume mit untergliederten Begrenzungsflächen ........................ 83 2.2 Statistische Raumakustik..................................................................... 84 B. Das Schallempfinden............................................................... 93 I. Aufbau und Funktion des Gehörs................................................................... 93 II. Tonhöhe .............................................................................................. 95 1 Das Tonhöhenempfinden........................................................................... 95 1.1 Hörbarer Frequenzbereich................................................................... 96 1.2 Das Tonhöhenempfinden als Funktion der Frequenz .......................... 96 1.3 Minimal wahrnehmbare Tonhöhenunterschiede ................................. 98 1.4 Kennzeit der Tonhöhenwahrnehmung ................................................ 99 2 Frequenzumfang wichtiger Schallquellen.................................................. 100 III. Lautstärke .......................................................................................... 102 1 Das Lautstärkeempfinden .......................................................................... 102 1.1 Grenzen des Lautstärkeempfindens ............................................... 102 1.2 Das Lautstärke- und Lautheitsempfinden als Funktion der physikalischen Kenngröße... 104 1.3 Lautstärkewirkung kurzzeitiger Schallereignisse................................ 107 1.4 Der Verdeckungseffekt........................................................................ 108 1.5 Gesamtlautstärke mehrerer Schallereignisse ....................................... 110 2 Lautstärkeumfang einiger Schallquellen.................................................... 112 IV. Klangfarbe ............................................................................................ 112 V. Einschwingvorgänge................................................................................... 116 1 Physiologische Einschwingzeit des Ohres................................................. 116 2 Unterscheidungsvermögen bei verschiedenen Einschaltvorgängen 116 3 Verwischungsschwelle............................................................................... 117 4 Das Gesetz der ersten Wellenfront (Precedence-Effekt) ........................... 117 VI. Räumliches Hören ................................................................................... 118 1 Richtungshören.......................................................................................... 119 1.1 Richtungswahrnehmung durch Laufzeitunterschiede ......................... 119 1.2 Richtungswahrnehmung durch Intensitätsunterschiede ....................... 120 1.3 Richtungswahrnehmung durch Klangfarbenunterschiede .................... 123 1.4 Beiträge der Laufzeit-, Intensitäts- und Klangfarbenunterschiede zum Gesamt-Richtungshören ... 123 2 Wahrnehmbarkeit der Schallquellenentfernung ........................................ 125 2.1 Entfernungswahrnehmung durch Hallerscheinungen .......................... 125 2.2 Entfernungswahrnehmung durch Klangfarbenunterschiede ................ 125 2.3 Entfernungswahrnehmung durch Lautstärkeänderungen .................... 125 3 Wahrnehmbarkeit der Schallquellenausdehnung....................................... 126 VII. Wahrnehmbarkeit von Verzerrungen ........................................................... 126 1 Lineare Verzerrungen ................................................................................ 127 1.1 Dämpfungsverzerrungen ..................................................................... 127 1.2 Laufzeitverzerrungen .......................................................................... 128 2 Nichtlineare Verzerrungen......................................................................... 130 3 Modulationsverzerrungen .......................................................................... 132 C. Grundlagen der Übertragungstechnik.......................................... 140 1 Die elektronische Schallübertragung ......................................................... 140 2 Modulation................................................................................................. 143 3 Modulationsverfahren................................................................................ 144 a) Amplitudenmodulation AM .................................................... 144 b) Frequenzmodulation FM..................................................... 144 c) Phasenmodulation PM..................................................... 144 d) Puls-Amplituden-Modulation PAM.................................................. 144 e) Pulsdauermodulation PDM.................................................. 144 f) Pulsphasenmodulation PPM................................................... 146 4 Multiplex-Verfahren .................................................................................. 146 4.1 Frequenz-Multiplex-System................................................................ 147 4.2 Zeit-Multiplex-System ........................................................................ 147 5 Rundfunkübertragung................................................................................ 150 6 Die digitale Übertragungsform .................................................................. 154 6.1 Analog-und Digitalübertragung im Vergleich..................................... 155 6.2 Die Digitalübertragung durch Puls-Code-Modulation (PCM) ............ 156 6.2.1 Der Abtastvorgang ..................................................................... 156 6.2.2 Die Quantisierung....................................................................... 157 6.2.3 Die Codierung ............................................................................ 158 6.3 Konversionsschaltungen...................................................................... 161 6.3.1 Analog/Digital-Wandler ............................................................. 161 6.3.2 Digital/Analog-Wandler ............................................................. 163 D. Künstlerisch-technischen Probleme der Schallaufnahme und Übertragung ... 165 I. Optimale Akustik des Aufnahmeraumes ........................................................ 165 II. Mikrofonanordnung ...................................................................................... 168 1 Mikrofonaufstellung ................................................................................. 173 2 Tonaufnahmen mit Bild ............................................................................ 176 2.1 Feststehende Mikrofone, die im Bild erscheinen dürfen.................... 176 2.2 Feststehende Mikrofone, die nicht sichtbar sein sollen ..................... 176 2.3 Bewegliche Mikrofone, die sichtbar sein dürfen ............................... 177 2.4 Bewegliche Mikrofone, die nicht im Bild erscheinen dürfen............. 178 3 Probleme der Lichtgestaltung bei Tonaufnahmen mit Bild ...................... 180 III. Aussteuerung ..........................................................................................183 IV. Stereofonische Übertragungswege ................................................................ 184 1 Räumliche Beziehungen bei der mehrkanaligen Übertragung.................. 185 2 Zweikanahge raumbezügliche stereofonische Übertragung ...................... 189 2.1 Zweikanahge Wiedergabe ...................................................................190 2.1.1 Lokalisierung durch Intensitätsunterschiede .............................. 190 2.1.2 Lokalisierung durch Laufzeitunterschiede ................................. 194 2.1.3 Kompensation verfälschender Einflüsse .................................... 197 2.2 Zweikanahge Aufnahme ..................................................................... 200 2.2.1 Intensitätsunterschiede der Mikrofonpegel ................................ 200 2.2.2 Laufzeitunterschiede ................................................................. 204 2.2.3 Überlagerung der Intensitäts- und Laufzeitunterschiede .......... 207 2.2.4 Mikrofonanordnungen ............................................................... 207 2.2.5 Störung der stereofonischen Aufnahme .................................... 214 2.2.6 Mikrofonanordnung bei der Intensitätsstereofonie ................... 214 3 Vielkanalige stereofonische Übertragung ................................................. 220 4 Ambiofonie ................................................................................................221 5 Quadrofonie .............................................................................................. 222 5.1 Das Vierkanal-System (4-4-4) ........................................................... 224 5.2 Die Matrix-Systeme [4-2-4] ............................................................... 224 5.3 Quasi-Quadrofonie (2-2-4) ................................................................. 227 6 Das Dolby Surround System ..................................................................... 228 7 Der 3/2-Stereo-Standard ........................................................................... 231 8 Kunstkopfstereofonie ................................................................................ 232 9 Das Eidofonie-Verfahren .......................................................................... 225 10 Die Wellenfeldsynthese (WFS) .............................................................. 239 E. Studiogeräte und Studioeinrichtungen .......................................... 246 I. Schallwandler ..............................................................................................246 1 Mikrofone ..................................................................................................247 1.1 Kontaktmikrofone .............................................................................. 247 1.2 Elektrostatische Mikrofone ................................................................ 247 1.2.1 Niederfrequenzschaltung ......................................................... 248 1,2.2 Das Elektret-Prinzip ................................................................. 250 1.2.3 Hochfrequenzschaltung ............................................................ 252 1.2.4 Richtcharakteristiken und Kapselausführungen ........................253 1.3 Interferenz-Mikrofone .........................................................................261 1.4 Elektrodynamische Mikrofone ......................................................263 1.4.1 Bändchenmikrofon .....................................................................263 1.4.2 Tauchspulmikrofon.....................................................................264 1.5 Piezoelektrische Mikrofone.................................................................266 1.6 Mikrofone für Sonderzwecke ............................................................. 267 1.6.1 Koinzidenz-Mikrofone ............................................................... 267 1.6.2 Lavalier-Mikrofone .................................................................... 269 1.6.3 Grenzflächen-Mikrofone ............................................................ 270 1.6.4 Das Zoom-Mikrofon................................................................... 272 1.6.5 Digitale Mikrophontechnik - Solution D .................................... 274 2 Lautsprecher............................................................................................... 275 2.1 Elektrodynamische Lautsprecher......................................................... 275 2.1.1 Aktive Lautsprecher-Kombinationen ......................................... 279 2.1.2 Das Walsh-System...................................................................... 280 2.1.3 Lautsprecher mit Regelkreis ....................................................... 281 2.2 Elektrostatische Lautsprecher.............................................................. 284 2.3 Piezoelektrische Lautsprecher ............................................................. 285 2.4 HP-Lautsprecher................................................................................... 285 2.5 Der Plasma-Wandler ........................................................................... 286 3 Strahlungsverhältnisse ................................................................................ 288 II. Verstärker............................................................................................... 294 1 Kopplungsarten von Verstärkern ............................................................... 294 2 Studioverstärker ......................................................................................... 297 2.1 Mikrofonverstärker.............................................................................. 298 2.2 Knotenpunktverstärker ........................................................................ 300 2.3 Ausgangs- und Trennverstärker........................................................... 300 2.4 Verteiler-Verstärker............................................................................. 303 3 Leistungsverstärker.................................................................................... 303 III. Einsteller und Regler ..................................................................................... 306 1 Pegelsteller................................................................................................. 306 1.1 Aufbau der Pegelsteller ....................................................................... 307 1.2 Schaltungsarten.................................................................................... 307 1.2.1 T-und H-Schaltung ..................................................................... 307 1.2.2 L-Schaltung................................................................................. 307 1.2.3 π-Schaltung ................................................................................. 308 1.3 Aktive Pegelsteller............................................................................... 309 1.4 Elektronisch gesteuerte Pegelsteller .................................................... 309 1.5 Panoramasteller.................................................................................... 311 2 Regelverstärker .......................................................................................... 314 2.1 Statische u. dynamische Eigenschaften von Regelverstärkern..............315 2.2 Regelverstärker mit variablen Eigenschaften........................................319 - Der Limiter .......................................................................................321 - Der Kompressor................................................................................322 2.3 Der Transienten-Limiter........................................................................323 2.4 Kompander-Systeme .............................................................................324 2.4.1 Die Dolby-Systeme ......................................................................325 - Das Dolby-A-System...............................................................325 - Das Dolby-B-System ...............................................................326 - Das Dolby-C-System ..............................................................327 - Das Dolby-SR-System ............................................................328 2.4.2 Der telcom-Kompander...............................................................329 3 Verzerrer und Entzerrer..............................................................................331 3.1 Hoch-Tiefentzerrer ..............................................................................332 3.2 Hörspielverzerrer .................................................................................332 3.3 Präsenzfilter .........................................................................................333 3.4 Tiefensperre .........................................................................................334 3.5 Höhensperre.........................................................................................335 3.6 Universalentzerrer................................................................................336 3.7 Programm-Entzerrer mit automatischer Steuerung..............................343 3.7.1 Der „De-Esser“ oder Filter-Limiter.............................................343 3.7.2 Das „Noise Gate“ ein Programm gesteuertes Rauschfilter .........345 3.7.3 Restauration historischer Aufnahmen .........................................348 IV. Kontrollinstrumente ................................................................................349 1 Aussteuerungsmesser .................................................................................349 1.1 Forderungen an einen Aussteuerungsmesser .......................................350 1.1.1 Anzeigebereich ...........................................................................350 1.1.2 Frequenzgang..............................................................................350 1.1.3 Dynamische Eigenschaften .........................................................350 1.2 Ein Standard-Aussteuerungsmesser.....................................................352 1.3 Aussteuerungsmesser mit opto-elektronischer Anzeige ......................353 1.4 Aussteuerungsmesser mit Pegelbildgerät.............................................355 1.5 Aussteuerungskontrolle mit Frequenzanalyse .....................................356 2 Korrelationsmesser.....................................................................................357 3 Aussteuerungsmesser für Surround-Sound ................................................359 V. Die Erzeugung künstlicher Klangeffekte .....................................................360 1 Künstlicher Nachhall..................................................................................360 1.1 Der Hallraum ......................................................................................360 1.2 Die Nachhallplatte ..............................................................................361 1.3 Die Nachhallfeder ...............................................................................362 1.4 Digitale Systeme für die elektronische Nachhallerzeugung ................363 2 Die elektronische Erzeugung von Klängen................................................367 2.1 Das MIDI-System...............................................................................368 2.2 Der Synthesizer...................................................................................370 3 Der Vocoder...............................................................................................372 4 Das „Leslie-System“ ..................................................................................373 5 Phasing und Flanging-Effekte....................................................................375 6 Der Harmonizer..........................................................................................378 F. Schallspeicherung.................................................................380 I. Analoge Schallspeicherverfahren ................................................................380 1 Magnettonverfahren...................................................................................381 1.1 Magnetische Grundbegriffe.................................................................381 1.1.1 Magnetische Grundgrößen .........................................................381 1.1.2 Magnetismus...............................................................................383 1.1.3 Magnetisierungskurve ................................................................384 1.1.4 Entmagnetisierung ......................................................................386 1.1.5 Remanenzkurve ..........................................................................387 1.2 Theorie der magnetischen Schallspeicherung .....................................388 1.2.1 Löschvorgang .............................................................................390 1.2.2 Aufzeichnungsvorgang...............................................................392 1.2.3 Zustand des Tonträgers nach der Aufnahme ..............................405 1.2.4 Einflüsse fremder Felder auf Tonträger nach Aufwicklung .......407 1.2.5 Abtastvorgang.............................................................................411 1.3 Einrichtungen der Magnettontechnik ..................................................419 1.3.1 Tonträger ....................................................................................419 1.3.2 Magnetköpfe...............................................................................432 1.3.3 Magnetton-Verstärker.................................................................435 1.4 Magnettonanlagen ...............................................................................440 1.4.1 Zweikanal-Anlagen ....................................................................440 1.4.2 Mehrspurtechnik.........................................................................442 1.5 Laufwerke ...........................................................................................446 1.5.1 Praktische Ausführungen der Laufwerke ...................................447 1.5.2 Magnetbandlaufwerk..................................................................447 1.5.3 Magnetfilmlaufwerk ...................................................................451 1.6 Die Synchronisierung von Ton und Bild.............................................454 1.6.1 Gleichlauf Systeme für perforierte Bänder.................................454 1.6.2 Pilottonverfahren ........................................................................457 1.7 Der elektronische Schnitt ....................................................................459 1.7.1 Die longitudmale Timecode-Aufzeichnung / LTC-Code .........462 1.7.2 Der Vertical Interval Timecode / VITC-Code............................464 1.7.3 Der Control Track Timecode / CTL-Code .................................464 1.7.4 Der Rewritable Consumer Timecode / RCTC-Code .................464 1.7.5 Time-Code-Aufzeichnung bei Audiogeräten..............................464 1.8 Laufwerkssteuerungen ........................................................................466 2 Lichttonverfahren ......................................................................................468 2.1 Fotometrische und fotochemische Grundbegriffe...............................468 2.1.1 Transparenz ................................................................................468 2.1.2 Schwärzung und Schwärzungsmessung .....................................468 2.1.3 Schwärzungskurve......................................................................469 2.2 Die fotografische Schallaufzeichnung ................................................470 2.2.1 Prinzip und Schriftarten ............................................................. 470 2.2.2 Aufzeichnungsvorgang .............................................................. 472 2.2.3 Exposition und Bearbeitung des Tonträgers .............................. 476 2.2.4 Abtastvorgang ............................................................................ 481 2.3 Einrichtungen für die Lichttonaufnahme ............................................ 484 2.3.1 Stereofonische Lichttonaufzeichnung ........................................ 487 2.3.2 Das „Dolby"-Lichttonverfahren ................................................. 488 2.3.3 Die Laser-Beam-Lichttonaufzeichnung...................................... 491 2.4 Lichttonspuren auf Bildfilmen ...........................................................495 2.5 Einrichtungen für die Lichttonwiedergabe ......................................... 495 3 Nadeltonverfahren, die mechanische Schallspeicherung ...........................499 3.1 Prinzip und Schriftarten ..................................................................... 499 3.2 Aufzeichnungsvorgang ...................................................................... 501 3.3 Vervielfältigung ................................................................................. 509 3.4 Abtastvorgang.................................................................................... 513 3.5 Plattenlaufzeit .................................................................................... 520 3.6 Tonträger............................................................................................ 521 3.7 Laufwerk............................................................................................ 521 II. Digitale Schallspeicherveriahren................................................................. 524 1 Grundzüge der digitalen Schallaufzeichnung............................................ 525 1.1 Die Digitalisierung des Audio-Signals ............................................... 529 1.2 Quantisierung...................................................................................... 530 1.3 Codierung ........................................................................................... 530 1.4 Fehlerschutz / Error Correction Coding / ECC................................... 534 1.5 Die Wiedergewinnung des analogen Audio-Signals .......................... 536 1.6 Digitale Schnittstellen......................................................................... 538 1.7 Datenreduktion ................................................................................... 539 2 Magnetbandverfahren ............................................................................... 544 2.1 Längsspuraufzeichnung ...................................................................... 544 2.1.1 Das DASH-Format..................................................................... 544 2.1.2 Das S-DAT-System ................................................................... 549 2.2 Schrägspuraufzeichnung..................................................................... 552 2.2.1 Die Audio-Quasi-Videoaufzeichnung ....................................... 554 2.2.2 Das R-DAT-System................................................................... 557 2.3 Elektronischer Schnitt zur Nachbearbeitung von Digitalaufnahmen................ 562 2.3.1 Elektronischer Schnitt mit digitalen Magnetbandmaschinen ..... 562 2.3.2 Das „Computer-Editing-System“ von Soundstream .................. 565 3 Die Compact-Disc-Systeme ................................................................... 568 3.1 CD-A / Die digitale Schallplatte „Compact-Disc“.............................. 568 3.1.1 Das optische Prinzip .................................................................. 570 3.1.2 Signalaufbereitung und Codierung ............................................ 573 3.1-3 Die Herstellung der Compact-Disc............................................ 577 3.1.4 Der Wiedergabevorgang............................................................ 582 3.2 CD-ROM............................................................................................ 589 3.3 CD-I / CD-Interaktiv .......................................................................... 591 3.4 CD-ROM-XA..................................................................................... 591 3.5 PCD / Photo-CD................................................................................. 592 3.6 CD-FMV / Full Motion Video-CD .................................................... 593 3.7 CD-R / Compact Disc Recordable ..................................................... 595 3.8 CD-RW / Compact Disc Rewritable .................................................. 597 3.9 DVD / Digital Versatile Disc ............................................................ 599 3.10 SACD / Die Super Audio CD .......................................................... 603 3.11 HD-DVD und Blu-ray-Disc ............................................................. 605 3.12 HVD – Holographic Versatile Disc ..................................................... 607 4 Magneto-optical-Disc - MOD................................................................... 608 5 Magnetplattenspeicher ........................................................................ 613 6 Digitale Lichttonaufzeichnung.................................................................. 615 6.1 Grundüberlegungen............................................................................ 615 6.2 Das Dolby SR*D Verfahren............................................................... 618 6.3 Das SDDS System von Sony.............................................................. 619 6.4 Das DTS System ................................................................................ 620 6.5 Das THX-System ............................................................................... 621 G. Studioräume und Tonregieanlagen............................................... 622 1 Studioräume.............................................................................................. 622 2 Schaltungen für die Tonregie.................................................................... 623 2.1 Ein Standard-Mischpult...................................................................... 626 2.2 Eine Regieeinrichtung für Musikaufnahmen...................................... 630 2.3 Eine Regieschaltung zur Darstellung von Nachhalleffekten .............. 631 2.4 „In-Line“-und „Routing“-Schaltungen............................................... 632 2.5 Die automatische Abmischung von Mehrspuraufnahmen ................. 635 2.6 Die Nachsynchronisation von Film-und Videoproduktionen............. 637 2.6.1 Die Nachsynchronisation mit Filmschleifen.............................. 637 2.6.2 Die Nachsynchronisation mit videotechnischen Mitteln .......... 640 2.7 Einrichtungen für die Mischung von Tonfilmen ................................ 643 2.8 Modul-Technik................................................................................... 650 2.9 Die zentrale Speisung von Mikrofonen.............................................. 654 2.9.1 Tonaderspeisung (DIN 45595) .................................................. 654 2.9.2 Phantomspeisung (DIN 45596) ................................................. 655 2.10 Drahtlose Mikrofontechnik .............................................................. 656 2.11 Beschallungsanlagen..........................................................................657 3 Digitale Mischpult-Systeme ......................................................................661 4 Hard-Disk-Systeme und das „bandlose Studio“ ........................................671 4.1 Die nichtlineare Bearbeitung von Programmen / NES-Systeme ........674 4.2 Das DYAXIS-System.........................................................................675 4.3 Das Synclavier....................................................................................677 4.4 Systeme für die Ton- und Bildbearbeitung.........................................680 4.5 ProTools .............................................................................................681 4.6 Der AVID-Media-Composer..............................................................685 5 Digitale und analoge Systeme in der Praxis……………………………...687 H. Qualitätsparameter der elektrischen Schallübertragung ...................694 I. Lineare Verzerrungen ..................................................................................694 II. Nichtlineare Verzerrungen ...........................................................................695 III. Dynamikeinschränkungen .............................................................................696 1 Elektrische Grenzen der übertragbaren Dynamik......................................696 2 Akustische Grenzen der übertragbaren Dynamik ......................................699 3 Praktische Begrenzung der übertragbaren Dynamik in den verschiedenen Übertragungswegen...700 J. Messtechnik ..............................................................................702 1 Messung linearer Verzerrungen.................................................................702 1.1 Dämpfungsverzerrungen .....................................................................702 1.1.1 Dämpfungsverzerrungen durch Pegelmessung..........................702 1.1.2 Dämpfungsverzerrungen durch Vergleichsmessung .................703 1.2 Phasendifferenzmessung .....................................................................704 1.2.1 Messung der Phasendifferenz mit Oszillografen ........................705 1.2.2 Phasendifferenzmessung nach Summen-Differenzmethode .....706 2 Messung nichtlinearer Verzerrungen.........................................................707 2.1 Eintonverfahren...................................................................................707 2.1.1 Messung des Klirrfaktors ...........................................................707 2.1.2 Messung der Klirrkoeffizienten..................................................708 2.2 Zweitonverfahren ................................................................................708 2.2.1 Messung der Differenztonfaktoren.............................................708 2.2.2 Messung der Modulationsfaktoren .............................................710 3 Messung der Modulationsverzerrungen............................................................712 3.1 Amplitudenmodulationsverzerrungen........................................................712 3.2 Frequenzmodulationsverzerrungen.............................................................712 4 Messung des Geräuschspannungsabstandes .....................................................713 5 Akustische Messverfahren................................................................................713 5.1 Ein universeller Messgenerator...................................................................713 5.2 Lautsprechermessungen.........................................................................715 5.3 Messungen an Mikrofonen.....................................................................716 5.4 Bestimmung der Nachhallzeit und des Schallabsorptionsgrades ................................717 5.5 Schalldämmungsmessungen...................................................................718 5.6 Frequenzanalyse.....................................................................................719 6 Messgeräte zur Überprüfung digitaler Übertragungsglieder.......................... ..722 7 Automatische Mess-Systeme.......................................................................724 Anhang.........................................................................................729 Die SI-Einheiten der wichtigsten Größen und ihre Umrechnung in andere Einheiten............730 Literaturverzeichnis.........................................................................................732 Sachverzeichnis ...............................................................................................753
********************************************************I*
von Michael Dickreiter (Autor)
Gebundene Ausgabe Verlag: Saur, K G; Auflage: 6 (1997) Sprache: Deutsch ISBN-10: 3-598-11320-X ISBN-13: 978-3-598-11320-8 Größe: 24,8x18,2x6,5cm
Korrektur-Anmerkungen zu Michael Dickreiter: Handbuch der Tonstudiotechnik, Band 1, die 6. Auflage, 1997: von Eberhard Sengpiel, mailto:[email protected] Im Dezember 2008 erschien die lange erwartete 7. Auflage dieses Standardwerks, bei der meine Anmerkungen zu Fehlern und die kritischen Hinweise wohl korrigiert wurden. Michael Dickreiter, Volker Dittel, Wolfgang Hoeg, Martin Wöhr Handbuch der Tonstudiotechnik 7. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der ARD.ZDF medienakademie, Nürnberg 1280 Seiten, 2 Bände, mit 703 Abbildungen und 156 Tabellen, Verlag: K G Saur, München ISBN-10: 3598117655 / ISBN-13: 978-3-598-11765-7 Das Handbuch der Tonstudiotechnik, seit seiner Erstausgabe vor mehr als 30 Jahren ein Klassiker unter den Fachbüchern der professionellen Audiotechnik, liegt seit Ende des Jahres 2008 nun in einer völlig neu bearbeitenden und erweiterten 7. Auflage vor. Herausgeber des zweibändigen Werkes ist die ARD.ZDF medienakademie, ehemals srt (Schule für Rundfunktechnik). Die Neubearbeitung der nunmehr 19 Kapitel wurde von Michael Dickreiter, Volker Dittel, Wolfgang Hoeg und Martin Wöhr vorgenommen, in Zusammenarbeit mit mehr als 25 Fachautoren aus Forschung, Lehre, Industrie und Praxis. Inhaltliche Schwerpunkte der 7. Auflage: Im Band 1 werden Grundlagen der Raumakustik, Schallquellen, Hörwahrnehmung, Mikrofone und Lautsprecher sowie die analoge Tonstudiotechnik ausführlich dargestellt. Die neu verfassten Kapitel zur Aufnahme- und Wiedergabetechnik, zur Klanggestaltung sowie zur Beschallung entsprechen den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis. Der Band 2 informiert umfassend über die aktuellen Sachgebiete der digitalen Audiotechnik. Neben einer umfangreichen Einführung zur Signalverarbeitung werden die wichtigsten Codierformate erläutert, die Möglichkeiten der digitalen Signalspeicherung, die neuen Übertragungssysteme, die digitale Betriebstechnik in Rundfunk und Studio sowie die Prozesse der gemeinsamen Ton- und Bildverarbeitung. Auch das Zusammengehen von technischem und multimedialem Workflow wird herausgearbeitet. Darüber hinaus finden sich mittlerweile standardisierte Methoden und Richtlinien, z. B. bei der Qualitätssicherung, aber auch bei der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz. Viele Kapitel verfügen über Angaben zu den relevanten Standards und zu weiterführender Literatur. Eine umfangreiche Liste englischer Fachwörter und Abkürzungen sowie ein detailliertes Sachregister runden das Werk ab. Zielgruppen des Buches sind u. a. Mitarbeiter von Medienproduktionsbetrieben, Studierende und Auszubildende in Medienberufen, Ausbildungsinstitute, Mitarbeiter flankierender Berufsgruppen (Journalisten) und technisch interessierte Laien. Inhalt der 7. Auflage des Handbuchs der Tonstudiotechnik: Akustik (Schallfeld, Raumakustik) Schallquellen (Menschliche Stimme, Musikinstrumente, Richtcharakteristiken, elektronische Klangerzeuger) Schallwahrnehmung (Das Gehör und seine Funktion, Schallereignis und Hörereignis, akustische Wahrnehmung, räumliches Hören natürlicher Schallquellen und bei elektroakustischer Wiedergabe) Schallwandler (Physikalische Prinzipien, Mikrofone, Lautsprecher, Kopfhörer, Drahtlostechnik) Aufnahmeverfahren (Binaurale Reproduktion, Zweikanal-Stereofonie, Mehrkanal-Stereofonie, Klangliche Aspekte, Kunstkopfverfahren, Wellenfeldsynthese) Klanggestaltung (Dynamik, Klangfarbe, Effektgeräte, Abbildungsrichtung, Raumeindruck, ästhetische Aspekte) Analoge Tonsignalspeicherung (Magnetische und mechanische analoge Aufzeichnung Analoge Tonregieanlagen (Aufbau einer Tonregieanlage, Leitungsführung und Anpassung, Mikrofonverstärker, Anschluss externer Geräte, Pegelsteller, Knotenpunkte, Verstärker, Signalüberwachung) Beschallung (Zentrale, dezentrale und richtungsbezogene Beschallungs-Systeme, Ausrüstung, Gerätetechnik, 100 V-Technik, Simulationstechniken) Analoge Tonmesstechnik (Verstärkung und Dämpfung, Verzerrungen, Störspannungen, Stereo-Parameter, Schallpegel, Messungen an Mikrofonen, Lautsprechern, Magnettonanlagen und Plattenspielern) Grundlagen der digitalen Tontechnik (A/D- und D/A-Wandlung, digitale Audiosignale, digitale Audioschnittstellen, digitale Austauschformate) Audiocodierung (MPEG-1/2/4, MP3, DOLBY-E, DOLBY DIGITAL, DTS, apt-X, Lossless Coding, Audio Watermarking und Fingerprinting, Digital Rights Management) Digitale Studioprozesse (Digitale Tonsignalbearbeitung, digitale Programmproduktion und Sendeabwicklung) Digitale Tonsignalspeicherung (Digitale Tonaufzeichnung, Mastering, digitale Tonarchive Fernsehtontechnik (Bild-/Ton-Relationen, Besonderheiten der Tonaufnahme, Synchronverfahren, Transcodierung, Embedded Audio, Schnittstellen) Digitale Betriebstechnik (Zentrale Einrichtungen, Übertragungswege) Rundfunksysteme (Übersicht, Modulationsverfahren, Kanalcodierung, terrestrische Systeme, Satellitensysteme, IPgestützte Systeme, programmbegleitende Dienste, Mehrkanalübertragung im Rundfunk) Qualitätssicherung (Tonsignalparameter, Dynamik, objektive und subjektive Qualitätskontrolle, Datensicherheit) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Richtlinien, Regelwerke, Gefährdungen, Elektrische Sicherheit) Fachwörter und Abkürzungen Englisch - Deutsch Sachregister Vorwort Das Handbuch der Tonstudiotechnik entwickelte sich seit seiner Erstausgabe im Jahr 1977 zu einem Klassiker unter den Fachbüchern der professionellen Audiotechnik. Hervorgegangen aus einem Ringordner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wuchs es im Laufe der Jahrzehnte zu einem anerkannten Standardwerk für Generationen von Anwendern und Studierenden aus allen Bereichen der Audiobranche heran. Die ersten vier Auflagen waren geprägt von den Grundlagen der Akustik bis hin zu den technologischen Grenzen der seinerzeitigen analogen Aufnahmeund Betriebstechnik mit all ihren typischen Ausprägungen. Mit der rasanten Entwicklung der digitalen Signalverarbeitung in den späten 1980er Jahren begann dann eine Revolution in der Audiowelt. Es wandelten sich die Möglichkeiten bei der Aufnahme, Bearbeitung, Speicherung und Verbreitung von Tonsignalen und eröffneten bisher nicht gekannte Chancen im Umgang mit Audio. Gleichzeitig erhöhten sich aber auch die Ansprüche an die Dienste. Diesen ersten Entwicklungen passte sich in den Jahren 1987 und 1990 die inhaltliche Ausformung des Handbuchs in einer neu bearbeiteten und erweiterten 5. Auflage an, gefolgt von einer weiteren überarbeiteten 6. Auflage im Jahr 1997. Danach begann die Zeit tief greifender Veränderungsprozesse in den Studios und tontechnischen Medien. Der audiofähige Computer in Echtzeit sowie vernetzte Systeme ermöglichten neue Gestaltungsformen. Ton, Bild und Text begannen auf Grund datentechnischer Fortschritte näher aneinander zu rücken. Arbeitsabläufe und Berufsbilder änderten sich radikal. Parallel dazu weiteten sich die Verbreitungswege für digitale Medieninhalte aus, die das Rezeptionsverhalten der Konsumenten drastisch veränderten. Es dauerte ein Jahrzehnt, bis sich schrittweise neue betriebliche Workflows auf Grund gesicherter Erkenntnisse und Standards etablierten. Ein Ende dieses dynamischen Ver- änderungsprozesses ist noch nicht in Sicht. Mit der vorliegenden 7. vollständig neu bearbeiteten und wesentlich erweiterten Auflage wird dieser Entwicklung Rechnung getragen. Das neue Werk befasst sich in zwei Bänden und 19 Kapiteln mit den wichtigsten aktuellen Aspekten der Tonstudiotechnik. Im ersten Band ist der Bestand der physikalisch-technischen Grundlagen des Schalls und verwandter Gebiete sowie die analoge Tonstudiotechnik aus der 6. Auflage grundsätzlich übernommen worden, allerdings nach einer erheblichen und nach neuesten Erkenntnissen abgestimmten Überarbeitung. Insbesondere Kapitel 5, das sich mit der Aufnahme- und Wiedergabetechnik, sowie Kapitel 6, das sich mit der Tongestaltung befasst, und Kapitel 9, Beschallung, sind vollständig neu verfasst worden. Bei der Themenwahl für den zweiten Band war die möglichst umfassende Information über die führenden Sachgebiete der digitalen Audiotechnik maßgebend. Das sind in erster Linie die Grundlagen, beschrieben in Kapitel 11, sowie in den Folgekapiteln die aktuellen Codierformate, die Möglichkeiten der digitalen Signalspeicherung, die neuen Übertragungssysteme, die heutige Betriebstechnik, wie sie in der professionellen Studioumgebung und im digitalen Rundfunk zur Anwendung kommt sowie die Prozesse der gemeinsamen Ton- und Bildverarbeitung. Darüber hinaus erschien es wichtig, in den systemorientierten Kapiteln das Zusammengehen von technischem und redaktionellem Workflow herauszuarbeiten und darzustellen. Ebenso finden normierte und mittlerweile standardisierte Methoden und Richtlinien, z. B. bei der Qualitätssicherung, Eingang in das Buch. Mit dem abschließenden Kapitel 19 zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Verästelungen von Vorschriften, Schutzmaßnahmen und Verantwortlichkeiten sich zunehmend auf alle Anwender in den tontechnischen Berufen verteilen und deshalb von allgemeinem Interesse sind. Vernetzte Strukturen, denen wir heute überall in der Audiotechnik begegnen, bedingen die enge Wechselwirkung von Funktionalität und Anwendung. Deshalb finden sich gelegentlich Begriffe und deren Erklärungen verteilt an mehreren Kapitelstellen, da sie dort dem besseren Sachverständnis dienen. Dieses erhöht die Lesbarkeit, ohne zu viel auf Querverweise hindeuten zu müssen. Das Handbuch der Tonstudiotechnik entstand aus dem gemeinsamen Bemühen von Herausgeber, Bearbeitern und Autoren, dem Benutzer ein umfassendes, zuverlässiges und detailreiches Nachschlagewerk an die Hand zu geben, das durch die Konzentration der Darstellung des Inhalts über die kommenden Jahre größtmögliche Nachhaltigkeit in der Audiotechnik bietet. Die ausführliche Darstellung von Standards und Literaturangaben am Ende eines jeden Kapitels, die alphabetische Auflistung häufiger Fachwörter EnglischDeutsch, die Erläuterung üblicher Abkürzungen und ein umfassendes Sachregister runden die sachdienliche Nutzung des Buches für den Leser ab. Grundsätzlich verzichtet wurde auf die Darstellung von Themen aus dem Consumerbereich. Das Bearbeiterteam, Martin Wöhr (Leitung), Michael Dickreiter, Volker Dittel und Wolfgang Hoeg, dankt den in der Autorenliste genannten Experten aus Forschung, Lehre, Industrie und Studiopraxis für die fachkundige Erstellung der Manuskripte. Der Dank richtet sich auch an Andreas Dittrich, Stefan Meltzer, Stephan Peus, Eberhard Sengpiel und Helmut Wittek für die kritische Durchsicht von Texten, er gilt ebenso Monika Gerber von der ARD.ZDF medienakademie für ihre engagierte Begleitung, Uwe Krämer für seine Vorarbeiten sowie Martin Bichler und Thomas Vogel, die mit viel Sachverstand die Abbildungen angefertigt haben. Der Dank der Bearbeiter geht schließlich auch an Michael Peschke, der mit der notwendigen Geduld das Layout erstellte.
Quelle:
http://www.sengpielaudio.com/DickreiterHandbuch1997TextanmerkungenSengpiel.pdf
Mein Sohn Dipl.Ing Christof Prenninger und ich hatten um 2000 ein kleines Tonstudio.
Wir haben für Marktmusikkapellen die Live Konzerte digital aufgenommen und daraus nur 200 Stk. CD gebrannt.
z.B. Die Konzerte der Marktmusikkapelle Lambach/Edt Leitung: Manfred See
in der Sporthalle Lambach
Musical Highligts Samstag, 16. Mai 1998 Konzert Filmmusik 10. Mai 1997 Silvesterkonzert 30. Dezember 1998 Silvester-Konzert 30. Dezember 1997 Konzert Highlights Silvesterkonzert 30. Dezember 1996
Frühjahrskonzert 1999
Silvester Gala 2000
Sony DADC Austria AG Werk 1 CD (Compact-Disc)-Herstellung, CD-Produktion, Customer Service, Niederalm 282, Tel. ++43 (0)6246 / 880-555, mailto:[email protected], Broschüre SONY CD-Audio Handbuch V4.0D (Juni 1996), Herstellung von CD Audio Tonträger nach vorhandener Digitalbänder, Spieldauer bei 12cm CD 77min bei 8cm CD 21 min 50 sec, Digitalbänder Abtastfrequenz 44,1 kHz Sampling Frequenz, Analogbänder 7,5 ips=19 cm/sec, Bandbreite 1/4", Referenzsignal 5sec. 1 kHz 0db, 10 kHz -10dB (Azimuth justierung), Labeldruck Spezifikation D, Strichstärke min. 0,15mm, Schrifthöhe min. 5 pt. ( 1 pt = 0,376 mm), Vierfarbendruck Cyan, Magenta, Yellow, Black, Textheft für Jewel case, Texteinlageblatt, Titelblatt, 12cm CD Kartonhülle oder Papiertasche, DAT-Aufnahmen der Silvester Konzerte der Marktmusikkapelle Lambach/Edt unter Manfred See 1995..2000, CD-Booklet, CD-Backliner, Standard Jewel Case & Tray, Bewertung: 1 Kategorie: christof Ort: A-5081 Anif Novon Tonstudio CD (Compact-Disc)-Herstellung, CD-Produktion, CD-Produktion, Präsentation auf Mini-CD-ROMs, Premastering-Leistungen auf SONIC SOLUTIONS - so günstig wie noch nie ! Litho, Labelfilm, Als Nachfolger der Firma Viennola BTG bieten wir Ihnen ab sofort die gewohnte Qualität an Premastering und Studioleistungen auf dem selben Equipment, jedoch zu Diskontpreisen an. Es betreut Sie weiterhin Herr Helmut Leistner, der Ihnen als technischer Leiter der letzten Jahrzehnte wohl bekannt sein dürfte. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Customer Service Center. DAT-Aufnahmen der Silvester Konzerte der Marktmusikkapelle Lambach/Edt unter Manfred See ab 2000, Bewertung: 1 Kategorie: christof Marktmusikkapelle Lambach/Edt Blasorchester, Kapellmeister Manfred See 1994..2005, Holger Mair Nachfolger, Vorgänger Karl Finkenzeller, ich habe die Blasmusik Silvesterkonzerte und Mai-Konzerte von 1995..1999 auf CD's produziert, Bewertung: 0 Kategorie: fritz Ort: A- Lambach Sennheiser HiFi Mikrofon: MD421N, Nr. 30379 und Nr. 30386, in Berlin bei der 25. Großen Deutschen Funkausstellung gekauft, STAND 1967 Kopfhörer Sennheiser HD 430, „optimal - offen" DIN A4 ausdrucken
********************************************************I*
Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE |